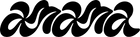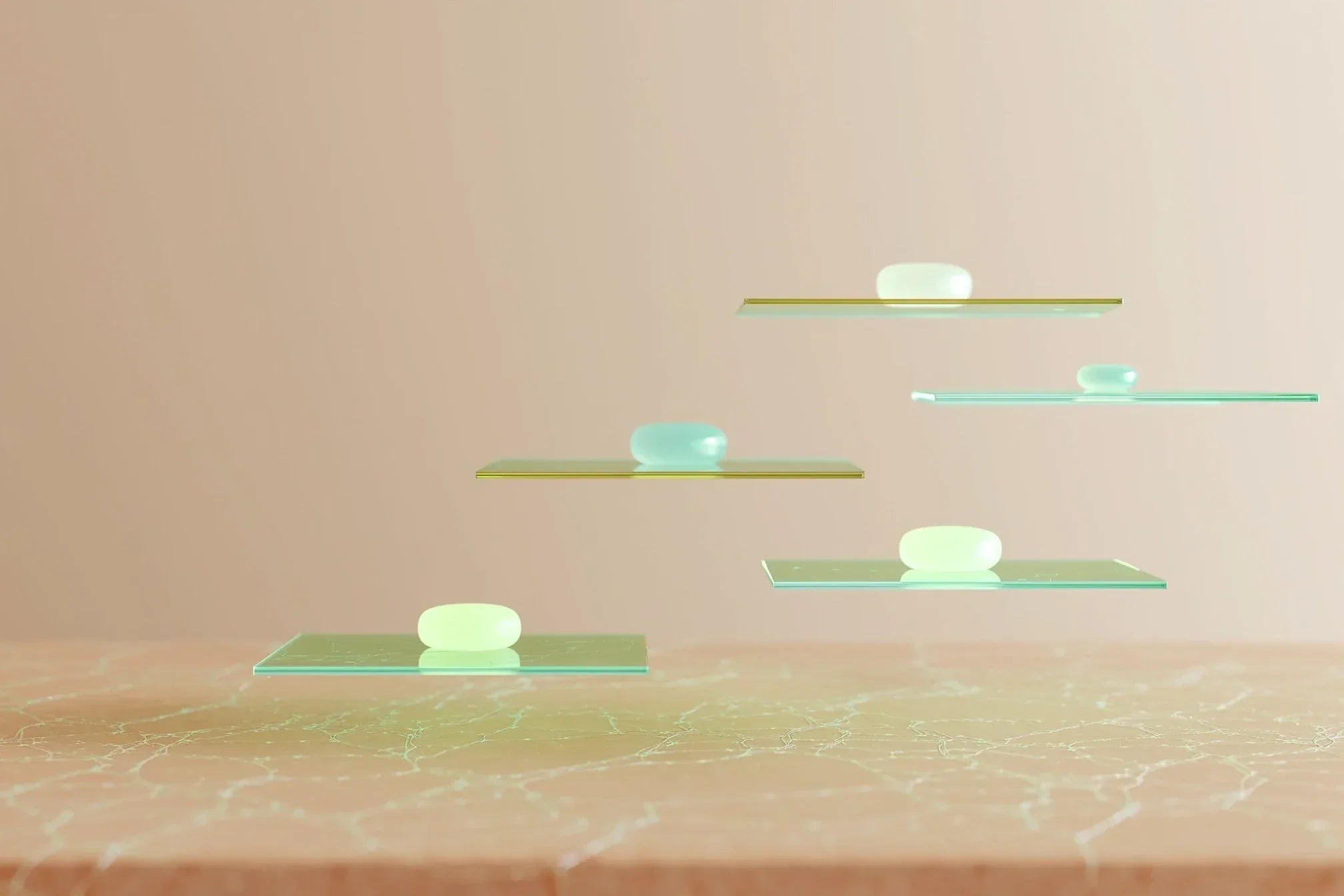Aktueller Stand: 1S-LSD legal (Oktober 2025) – Noch nicht ausdrücklich im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) oder im Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) verboten. Obwohl ein Verbot geplant ist, bleibt der Erwerb und Besitz bis zum Inkrafttreten der entsprechenden Änderungsverordnung legal.
Deutschlands Umgang mit psychedelischen Substanzen spiegelt ein komplexes Zusammenspiel aus gesundheitspolitischen Erwägungen, wissenschaftlichem Fortschritt und sich wandelnden gesellschaftlichen Haltungen gegenüber bewusstseinsverändernden Stoffen wider. Diese umfassende Betrachtung zeigt einen Rechtsrahmen im Übergang, in dem traditionelle Verbotsstrategien zunehmend auf evidenzbasierte therapeutische Anwendungen und wachsende internationale Reformbestrebungen treffen. Der rechtliche Status psychoaktiver Substanzen ist kein fixer Zustand, sondern ein leiser, fortlaufender Dialog zwischen menschlicher Neugier, chemischer Innovation und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Besonders deutlich wird dies in der Geschichte der LSD-Analoga, bei denen jede neue Molekülvariante eine spezifische rechtliche Reaktion ausgelöst hat. Diese Seite dient als Referenz, um diese Entwicklung zu beobachten und
Die LSD-Analoga-Chronik: Eine regulatorische Entwicklung
Die Geschichte der LSD-Analoga in Deutschland verdeutlicht die anhaltende Spannung zwischen chemischer Innovation und rechtlicher Kontrolle. Dieses „Katz-und-Maus-Spiel“ hat sich über fast ein Jahrzehnt entfaltet: Auf jede regulatorische Maßnahme folgte die Entwicklung neuer Verbindungen, die darauf abzielten, bestehende Beschränkungen zu umgehen.
Die erste bedeutende Welle von LSD-Analoga erschien in den Jahren nach Inkrafttreten des NpSG. Die Geschichte der LSD-Analoga in Deutschland lässt sich als Chronik dieser adaptiven Regulierung lesen: Sobald eine Substanz in den Anwendungsbereich des NpSG aufgenommen wurde, tauchte eine neue Verbindung mit leicht veränderter Molekülstruktur auf – und der Zyklus begann von vorn.
-
2. Juli 2019: 1P-LSD (1-Propionyl-lysergsäurediethylamid) wurde weithin bekannt und später durch überarbeitete NpSG-Bestimmungen erfasst.
-
2. Juli 2021: 1cP-LSD (1-Cyclopropylcarbonyl-LSD) erschien als Ersatzstoff und wurde anschließend in den Anwendungsbereich des NpSG einbezogen.
-
14. Oktober 2022: 1V-LSD (1-Valeryl-LSD), auch bekannt als „Valerie“, wurde verfügbar und später verboten.
-
März 2023: Die Formulierungen des NpSG wurden präzisiert, wodurch 1V-LSD eindeutig erfasst und untersagt wurde.
-
12. Mai 2023: 1D-LSD (1-(1,2-Dimethylcyclobutan-1-carbonyl)-LSD) wurde verboten und markierte für viele das Ende der leicht zugänglichen legalen LSD-Analoga.
-
14. Juni 2024: Der Bundesrat verabschiedete eine Änderung des NpSG zur Aufnahme von 1D-LSD; das Gesetz trat am 27. Juni 2024 in Kraft.
-
Juni 2024: 1S-LSD (1-(3-(Trimethylsilyl)propionyl)-LSD) trat als nächste Alternative auf; seine besondere Struktur lag zunächst außerhalb des bestehenden NpSG-Wortlauts.
-
26. September 2025: Der Bundesrat empfahl einen breiter gefassten Stoffgruppentext, der sämtliche LSD-Analoga, einschließlich 1S-LSD, erfassen sollte – ein Schritt, der einem faktischen pauschalen Verbot sehr nahe gekommen wäre.
-
1. Oktober 2025: Die Bundesregierung lehnte ein allgemeines Verbot ab und verwies auf verfassungsrechtliche Anforderungen an die Bestimmtheit von Normen. Stattdessen ist geplant, durch eine Verordnung bestimmte neue Derivate – wie 1S-LSD – ausdrücklich in Anlage 1 des NpSG aufzunehmen. Bis zum Inkrafttreten dieser Regelung bleibt 1S-LSD formal legal, auch wenn sich sein Status voraussichtlich ändern wird.
Das jüngste Kapitel: 1S-LSD
Im Juni 2024 erschien 1S-LSD (1-(3-(Trimethylsilyl)propionyl)-LSD) als nächster Ersatzstoff. Seine einzigartige Struktur mit einer Trimethylsilylgruppe lag zunächst außerhalb des bestehenden Wortlauts des NpSG. Regierungsquellen haben jedoch klar angekündigt, 1S-LSD durch eine Änderungsverordnung zum NpSG zu verbieten; die Umsetzung wurde bis zum 26. September 2025 erwartet.
Die Antwort der Bundesregierung auf die Empfehlungen des Bundesrates im Oktober 2025 verdeutlicht anhaltende politische Spannungen. Während einige Gesetzgeber eine umfassende „Blanket Ban“-Lösung forderten, die alle potenziellen LSD-Analoga erfassen würde, lehnte die Bundesregierung diesen Ansatz mit Verweis auf die verfassungsrechtlich geforderte Normenklarheit nach Artikel 103 des Grundgesetzes ab. Stattdessen planen die Behörden gezielte Ergänzungen, die spezifische Verbindungen wie 1S-LSD den bestehenden Verbotskategorien hinzufügen. Dieser Ansatz – gezielte Änderungen statt eines pauschalen Verbots – entspricht dem verfassungsrechtlichen Gebot rechtlicher Präzision. Bis dahin bleibt der Status unverändert. Diese Zeitleiste spiegelt eine komplexe und sich entwickelnde Beziehung wider und lädt zu einer fortlaufend reflektierten Beobachtung der Schnittstellen von Chemie, Kultur und Recht ein.
Der deutsche Rechtsrahmen: Ein duales System
Die Regulierung psychedelischer Substanzen in Deutschland erfolgt im Wesentlichen über zwei gesetzliche Instrumente, die unterschiedliche Grundhaltungen der Drogenpolitik verkörpern.
-
Das Betäubungsmittelgesetz (BtMG): Dies ist der klassische Ansatz Deutschlands, bei dem verbotene Substanzen wie LSD einzeln aufgeführt werden. Unter diesem Rahmen werden klassische Psychedelika, darunter LSD, Psilocybin, Psilocin, Mescalin und DMT, als Anlage-I-Stoffe eingestuft und damit als nicht verkehrsfähige Betäubungsmittel ohne anerkannte medizinische Verwendung behandelt.
-
Das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG): Dieses am 26. November 2016 in Kraft getretene Gesetz repräsentiert einen adaptiveren Ansatz. Anstatt einzelne Verbindungen zu benennen, definiert das NpSG ganze Klassen chemisch verwandter Stoffe. Diese „Stoffgruppen-Methodik“ ist der zentrale Rahmen, über den LSD-Analoga reguliert wurden. Dieser duale Ansatz entstand aus der Erkenntnis, dass die traditionelle Drogenpolitik mit der Innovationsgeschwindigkeit der synthetischen Chemie nicht Schritt halten konnte. Die enumerative Methode des BtMG verlangte eine Einzelbewertung und -auflistung jeder neuen Substanz und schuf dadurch Lücken, die Produzenten durch geringfügige molekulare Modifikationen ausnutzten. Der gruppenbasierte Ansatz des NpSG versucht, diese Lücken zu schließen, indem verbotene Strukturkategorien statt einzelner Moleküle definiert werden.
Nach dem NpSG unterscheiden sich die Sanktionen von klassischen Betäubungsmitteldelikten. Herstellung und Vertrieb bleiben Straftaten, die mit Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren (in besonders schweren Fällen bis zu zehn Jahren) geahndet werden können. Der Besitz zu Konsumzwecken gilt hingegen als Ordnungswidrigkeit und kann mit Bußgeldern von bis zu 30.000 € belegt werden, ohne zu einer strafrechtlichen Verfolgung zu führen. Diese Unterscheidung spiegelt die Einsicht wider, dass Konsumierende neuer psychoaktiver Substanzen häufig anders einzuordnen sind als klassische Drogenkonsumenten.